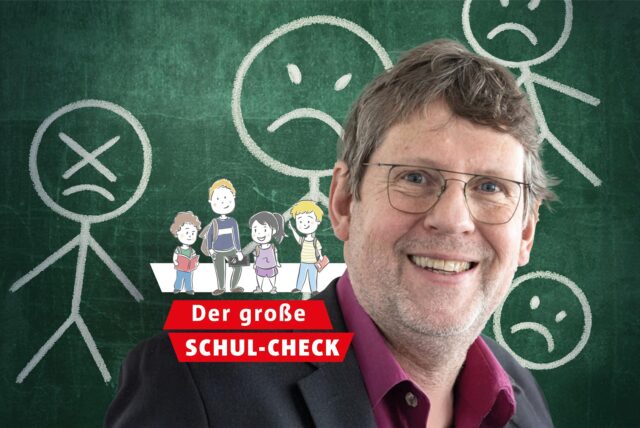
Eltern sind deutlich fordernder geworden, stellen Noten infrage und greifen schneller zu Beschwerden oder sogar Widersprüchen – oft ausgelöst durch Missverständnisse oder das Gefühl, ihr Kind werde ungerecht behandelt.
Besonders rund um die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse häufen sich die Beschwerden, wobei laut Lehrerverbänden auch schon an Grundschulen über einzelne Noten diskutiert wird. Der Druck auf dem Arbeitsmarkt und der Wunsch nach der bestmöglichen Ausbildung für die Kinder verstärken auch den Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer. Während Beschwerden meist auf Schulebene bleiben, stieg die Zahl der förmlichen Widerspruchsverfahren in den größten NRW-Bezirksregierungen zuletzt an – im Regierungsbezirk Düsseldorf etwa von 185 Fällen im Jahr 2023 auf 205 im Jahr 2024, wobei rund zehn Prozent der Fälle vor Gericht landeten. Auch die Bezirksregierung Arnsberg, Aufsichtsbehörde der Dortmunder Schulen, bestätigt einen Anstieg der Beschwerden in den vergangenen Jahren.
Es ist nicht nur der Druck am Arbeitsmarkt, der die Situation zwischen Lehrern und Eltern verschärft, sagt Bildungsforscher Dieter Dohmen vom Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in unserem Interview. Er weiß, was an deutschen Schulen schiefläuft und sieht große psychische und soziale Herausforderungen. Bei Eltern, Schülern und Lehrern.
Herr Dohmen, in einem anderen Interview sagen Sie: „Ein Teil der Eltern ist vollkommen durchgeknallt“ …
Ich halte nicht alle Eltern für durchgeknallt, aber es gibt immer wieder Einzelfälle, in denen Eltern in ihrer Fürsorge über das Ziel hinausschießen und extrem reagieren – zum Beispiel, wenn sie bei schlechten Noten sofort mit Anwälten drohen oder Lehrkräfte massiv unter Druck setzen. Manche Eltern kontrollieren ihre Kinder übermäßig oder mischen sich in jede Kleinigkeit ein, während andere sich kaum kümmern, aber bei Problemen sehr fordernd auftreten. Auch der mangelnde Respekt gegenüber Lehrkräften und überzogene Diskussionen in Elternchats sind Beispiele für Verhaltensweisen, die ich bisweilen als ‚durchgeknallt‘ empfinde. Das ist für Lehrkräfte oft sehr belastend, betrifft aber ausdrücklich nicht alle Eltern, sondern nur auffällige Einzelfälle.
Sie sagen, die psychischen und sozialen Herausforderungen bei Schülern nehmen zu. Woher kommt diese Entwicklung?
Die Zunahme psychischer und sozialer Belastungen betrifft nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene. Die letzten fünfzehn Jahre waren geprägt von Krisen wie der Corona-Pandemie, wirtschaftlichen Abschwüngen und dem Ukraine-Krieg. Viele Kinder und Jugendliche kennen kaum noch eine Welt ohne Krisen. Besonders die Pandemie hat dazu geführt, dass soziale Kontakte eingeschränkt waren und Vereinsamung entstand. Auch die verstärkte Nutzung von Social Media trägt dazu bei, da dort problematische Inhalte ungefiltert geteilt werden. Das alles wirkt sich auf das Verhalten und die Kommunikation von Eltern und Lehrkräften aus.
Welche Rolle spielen Social Media und digitale Kommunikation bei diesen Herausforderungen?
Fast alle Kinder und Jugendlichen sind heute auf Social Media aktiv. Dort werden nicht nur unrealistische Schönheitsideale transportiert, sondern auch verstörende Inhalte wie Gewaltvideos. Diese Dynamik gab es früher so nicht. Die Geschwindigkeit und Ungefiltertheit der digitalen Kommunikation führen dazu, dass Kinder und Jugendliche mit Inhalten konfrontiert werden, die sie emotional stark belasten können. Und gleichzeitig fühlen sie sich genötigt quasi permanent auch online zu sein und zu konsumieren oder interagieren.
Wie wirkt sich das auf die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern aus?
Es gibt es eine große Bandbreite an elterlichem Verhalten: von Überbehütung – den sogenannten „Helikoptereltern“ – bis hin zu Vernachlässigung. Manche Eltern versuchen, jede Schwierigkeit für ihr Kind aus dem Weg zu räumen, andere sind sehr distanziert oder wirken gar desinteressiert. Das kann zu Konflikten mit Lehrkräften führen, etwa wenn Eltern bei schlechten Noten sofort mit rechtlichen Schritten drohen oder den Respekt gegenüber Lehrkräften vermissen lassen. Letzteres ist gerade dann der Fall, wenn Eltern selbst psychisch belastet oder unter Stress sind; dann kommunizieren sie schnell weniger entspannt mit Lehrkräften.
Gibt es Studien dazu, wie viel Zeit Lehrkräfte für die Kommunikation mit Eltern aufwenden?
Für Lehrkräfte gibt es meines Wissens nach keine detaillierten Studien. Wir haben aber Schulleitungen befragt, wie viel Zeit sie für verschiedene Aufgaben aufwenden. Die Kommunikation mit Eltern nimmt dabei einen erheblichen Teil ein, nicht selten mehr als drei Stunden pro Woche.
Haben Konflikte, Beschwerden und rechtliche Schritte gegen Lehrkräfte zugenommen?
Gefühlt ja, aber belastbare Zahlen dazu fehlen. Die Bedeutung von Schulnoten als Auslöser für Konflikte ist gestiegen, weil sie für Bildungswege immer wichtiger werden. Gleichzeitig ist ihre Aussagekraft für andere Bereiche begrenzt, da Noten sehr individuell vergeben werden und nicht unbedingt Aussagen über die tatsächlichen Kompetenzen der Schüler widerspiegeln.
Braucht es alternative Formen der Leistungsbewertung?
Ja, es gibt Schulen, die auf Noten verzichten und stattdessen die individuellen Talente und Kompetenzen der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Ziel sollte sein, Kinder zu fördern und ihre Motivation zu stärken, anstatt sie nur zu bewerten. Lehrkräfte sollten mehr als Lernbegleiter und Talentscouts agieren, die Stärken fördern und Schwächen abbauen.

Was müsste sich in der Lehrerausbildung ändern, um Lehrkräfte besser auf die Zusammenarbeit mit Eltern vorzubereiten?
Die Lehrerausbildung muss praxisnäher werden. Kommunikation mit Eltern, Kollegium und Schülern sollte ein zentraler Bestandteil sein, wie auch vieles andere, was für das tägliche Arbeiten wichtig ist. Idealerweise sollten angehende Lehrkräfte ab dem ersten Semester regelmäßig in Schulen hospitieren und praktische Erfahrungen sammeln, diese dann an der Uni kritisch reflektieren. Das pädagogische Handwerkszeug sollte deutlich stärker im Fokus stehen, stattdessen liegt der Fokus zu stark auf Fachwissenschaften.
Welche Rolle spielen soziale und nationale Herkunft sowie Sprachkompetenz der Eltern bei Konflikten?
Sie spielen eine große Rolle. Wenn Eltern die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen oder aus anderen Kulturen stammen, entstehen schnell Missverständnisse. Es gibt aber auch positive Beispiele, wie Schulen mit Elterncafés oder multiprofessionellen Teams Brücken bauen und den Austausch fördern. Solche Ansätze helfen, Vertrauen aufzubauen und die Zusammenarbeit zu verbessern.
Wie können Eltern und Lehrkräfte zu mehr Gelassenheit und Vertrauen im Schulalltag finden?
Wir müssen weg von der überzogenen Bedeutung der Schulnoten und mehr auf die individuellen Talente und Lebenswege der Kinder schauen. Gelassenheit und gegenseitiges Vertrauen entstehen, wenn beide Seiten bereit sind, die Perspektive des anderen einzunehmen und Konflikte nicht sofort eskalieren zu lassen. Eine offene und respektvolle Kommunikation ist entscheidend.
Welchen Rat haben Sie für Eltern, die sich im Konflikt mit Lehrkräften oder dem Schulsystem überfordert fühlen?
Es hilft, sich auch einmal in die Perspektive des Gegenübers zu versetzen und nicht vorschnell zu handeln. Oft ist es sinnvoll, eine Nacht über ein Problem zu schlafen und dann das Gespräch zu suchen, anstatt sofort zu reagieren. Gelassenheit und Reflexion sind wichtige Schlüssel, um Konflikte zu vermeiden oder konstruktiv zu lösen.
Abschließende Gedanken?
Wir brauchen als Gesellschaft einen neuen Common Sense im Umgang miteinander – mehr Gelassenheit, Respekt und die Bereitschaft, auch eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen. Das gilt für alle Beteiligten im Schulsystem gleichermaßen.
Alle bislang erschienenen Serienteile gibt es unter rn.de/schul-check
Hinweis der Redaktion: Dieses Interview erschien ursprünglich am 19. Juni 2025.